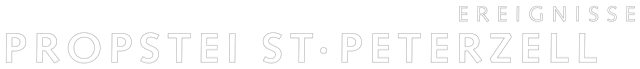von Jost Kirchgraber und Richard Butz
Wenn etwas verloren ist, heisst das nicht unbedingt, dass es nicht mehr besteht. Es finden und zeigen, beweist dessen Existenz. Hinter dem Willen, dies zu tun, steht die Überzeugung, dass das Verlorene es wert ist, wieder ans Licht gebracht und in Erinnerung gerufen zu werden.
«Junge St.Galler Malerei» will sagen, dass die Künstler, deren Arbeiten hier ausgestellt sind, damals zur jungen Generation gehört haben. Allerdings, der älteste dieser Gruppe ist August Wanner. Obwohl schon 1886 geboren, hatte sich Wanner der Moderne, und das hiess für ihn zunächst Expressionismus, gestellt und war der Lehrer von Ferdinand Gehr, Johannes Hugentobler, Willy Thaler und anderen.
«Junge» Kunst wurde gerade in den Zwanzigern in Deutschland zu einem Begriff, daher dieses Attribut.
«1920–1940» trifft den Zeitraum nicht ganz genau, da einzelne der hier vertretenen Maler den Schritt zur Moderne schon ein paar Jahre früher getan hatten, Sebastian Oesch zum Beispiel. Ihre Jugend fällt in die Blütezeit der Stickerei. Die meisten entstammen einem Milieu, das von der Textilindustrie mitgeprägt war. Weil sie wohl schon als Schüler zeichnerisch begabt schienen, war ihr Berufsweg vorgezeichnet: Textilzeichner, Stickereifachschule, allenfalls Merkantilabteilung der Kantonsschule. Als Branche geltend, deren Produkt sich zur Hauptsache aesthetisch definierte, wurde die Stickerei damals gern «die schönste aller Industrien» genannt. Ignaz Epper hätte Stickereizeichner wie sein Vater werden sollen, Gehr und Thaler waren zunächst gelernte Stickereizeichner; Sebastian Oesch, Theo Glinz und Heinrich Herzig hatten in St.Gallen die Stickereifachschule besucht, Bruno Kirchgraber und Carlos Schneider hätten in die väterlichen Fussstapfen als Stickereifachleute treten sollen. August Wanner war Lehrer an der Gewerbefachschule in St.Gallen für Stickereientwurf.
1914 brach der Krieg aus. Aus der Traum. Die ganze mondäne Welt der schönen Broderien versank. Und die vorgegebene Berufslaufbahn so vieler junger St.Galler löste sich in nichts auf. Gezwungen, einen anderen Weg zu beschreiten, entschloss sich deshalb dieser und jener – fast möchte man sagen wohl oder übel –, ein Malerleben zu versuchen, zog hinaus nach Berlin, München, Weimar oder Paris, vielleicht auch nach Italien, um Kunst zu studieren. Die meisten nach 1918, einige aber schon während der Kriegsjahre. Mitte der Zwanzigerjahre kehrten sie dann, erfüllt von neuen künstlerischen Ideen und Anregungen, wieder heim in die Ostschweiz. Aber die Arbeiten, die sie mitbrachten, und was nun an Zeichnungen, Gemälden und Holzschnitten entstand, war anders als das, was man hierzulande gewohnt war: es war berührt von der Moderne.«Moderne» meint das, was damals international los war: der deutsche Expressionismus (Berlin/München), die Neue Sachlichkeit (Weimar/Berlin), die befreite Farbe der Fauves und der Kubismus (Paris). Auch Hodler hatte allmählich angefangen auszustrahlen.
Diese Maler hatten es dann nicht leicht mit ihrer neuen Kunst. Hinzu kam, dass die Zeiten zunehmend schwieriger wurden für den Verkauf von Bildern: Stichwort Weltwirtschaftskrise. Zudem verfinsterte sich der politische Himmel bald bedrohlich von Deutschland her über Europa. Das löste Ängste aus. So geschah es, dass die meisten Künstler sich gezwungen sahen, wieder zurückzubuchstabieren (Gehr allerdings ausgenommen). Manch einer landete wieder beim Blumenstrauss für übers Sofa. Und wenn sich der eine in die Idylle flüchtete, sich zurückzog ins familiäre Schneckenhaus, suchte ein anderer Halt und Zuversicht im Religiösen. Weitere Gefahren lauerten im Heimatstil und in der schmissigen Boulevardmalerei. Zudem hatten die Künstler inzwischen Familien gegründet, die sie ernähren mussten, und die Gesellschaft hatte jetzt andere Sorgen, als sich mit moderner, und das hiess, anstrengender Kunst auseinanderzusetzen. Der Lichtensteiger Möbeldesigner Traugott Stauss ist ein Paradefall: Nachdem er eine Zeitlang ganz erstaunliche Bauhausmöbel geschaffen hatte, musste er wie irgend ein Steinmetz Grabsteine mit Rehlein darauf anfertigen, um überleben zu können.
«Verlorene Moderne»: Es geht auch um eine Spurensuche. Um den Versuch, wiederzufinden, was schon von den Künstlern selber verlassen und durch ein anderes Stilverhalten überlagert worden war und seit der Jahrhundertmitte auch aus dem öffentlichen Bewusstsein allmählich verschwunden ist. Ja, verloren gegangen. Man könnte sogar sagen: verschollen. Der Zeitpunkt ist gerade noch günstig, leben doch die meisten direkten Nachkommen der ausgewählten Maler noch. Sie können, inzwischen selber 60 bis 80 Jahre alt, noch Auskunft geben über ihre Väter, ausschliesslich Väter – denn Künstlerinnen aus dieser Zeit hatten andere Schwerpunkte. Sophie Teuber-Arp kann nicht als St.Gallerin gelten, und Maria Geroe-Tobler sowie Klara Fehrlin oder Hedwig Scherrer haben sich nicht primär als Malerinnen verwirklicht. Martha Cunz gehört bereits der vorausgehenden Generation an.
Diese Ausstellung versammelt 13 Maler. Das ist eine Auswahl. Es fehlen zum Beispiel Charles Hug, Willy Koch, Albert Saner, Hans Stettbacher und andere. Diese gehören allerdings nicht in die Reihe, da sie letztlich die impressionistische Tradition weiterpflegten und sich den genannten Strömungen so bewusst nicht gestellt haben. Andere Maler wie Albert Schenker und Karl Peterli haben sich in ihrer Malerei erst später entschieden und die persönliche Ausdrucksweise erst später gefunden. Von Willy Jahn oder Josef Büsser fand sich nur etwa ein Einzelstück, das in diese Ausstellung gepasst hätte.
Ein neues Kapitel der modernen Malerei in der Ostschweiz beginnt mit Diogo Graf.
Jost Kirchgraber